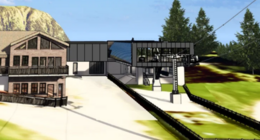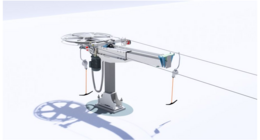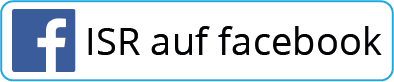Das erfolgreiche Management touristisch genutzter Bergebiete erfordert vielfach Änderungen und Anpassungen im Gelände. Ist ein Projekt in der sensiblen Berglandschaft bewilligt, kann die Behörde zur schonenden Umsetzung in einigen Alpenstaaten eine sogenannte „Ökologische Bauaufsicht“ vorschreiben.
Die Ökologische Bauaufsicht ist ein Sonderfall der örtlichen Bauaufsicht und besitzt jedoch einen anderen Aufgabenschwerpunkt. Ziel ist es, durch die Überwachung und Begleitung des Vorhabens bei potenziell schwerwiegenden Eingriffen in den Naturhaushalt für eine schonende Ausführung zu sorgen. Die Vorschreibung einer Ökologischen Bauaufsicht soll auf der einen Seite klare Vorgaben durch die Projektplanung und den naturschutzfachlichen Sachverständigen enthalten. Auf der anderen Seite soll jedoch ein Spielraum bleiben, um bei ökologisch relevanten Gefahren während der Bautätigkeit reagieren zu können. Damit soll die Ökologische Bauaufsicht zur Vermeidung von negativen Effekten für den Naturhaushalt beitragen. Sie ist jedoch nicht für die eigentliche Machbarkeit des Projektes verantwortlich. In der Regel gilt hier auch das Verursacherprinzip, d. h. die Ökologische Bauaufsicht ist vom Projektwerber (Bauherrn) zu bezahlen. Die Vorgaben und die Kontrolle der Leistungen obliegen jedoch den Behörden. Damit ist die Ökologische Bauaufsicht Diener zweier Herrn und in einer schwierigen Position, die auch die Landesumweltanwaltschaft in Salzburg als Gratwanderung beschreibt.
Studie zur Ökologischen Bauaufsicht
Eine Studie an der Universität für Bodenkultur (Meindl 2013) sollte zeigen, ob und wie dieses Instrument im deutschsprachigen Alpenraum vor allem in Skigebieten eingesetzt wird und welche Erfahrungen damit bestehen. Dabei zeigte sich, dass sich nicht nur die gesetzlichen Voraussetzungen, sondern auch Einsatz und Erwartungen in den verschiedenen Ländern deutlich unterscheiden.
In der Schweiz ist dieses Instrument nicht gesetzlich geregelt. Lediglich bei Großprojekten kann es im Rahmen von UVP-Verfahren zu einer Kontrolle durch Ökologische Büros kommen.
In Südtirol/Italien gibt es bei Projekten, die „eine landschaftliche Ermächtigung brauchen“ eine Reihe von Auflagen. Diese beinhalten ökologische Belange und formulieren entsprechende Auflagen. Nach Auskunft der befragten Experten lässt sich durch die meist späte Beauftragung oft nur mehr eine Schadensminderung erreichen.
In Österreich ist nur in den Bundesländern Salzburg, Tirol und Kärnten die Ökologische Bauaufsicht in den Landesgesetzen der Länder verankert. In Oberösterreich sind nur indirekte Bezüge zu den gesetzlichen Grundlagen vorhanden. Von den interviewten Experten werden Ausbildungsdefizite sowie das Fehlen von Regelwerken und entsprechenden Richtlinien bemängelt. Eine gute Planung, ergänzt durch einen detaillierten Bescheid, wird als Grundlage für eine reibungslos ablaufende Ökologische Bauaufsicht gesehen. Von Seiten der Salzburger und Tiroler Experten wird hierbei auf eine entsprechende Gliederung und eine Fristensetzung in den Bescheidauflagen hingewiesen. Eine Dokumentationsvorlage, welche als „Mindestanforderung an Berichte der Ökologischen Bauaufsicht für Aufstiegshilfen und Pistenprojekte“ bezeichnet wird, gibt es nur in Tirol. In Salzburg ist diese je nach Projekt, in Abhängigkeit vom Bescheid und der Notwendigkeit, frei gestaltbar. Hier wünschen sich die befragten technischen Büros klare Vorgaben und einheitliche Regelungen.
In Deutschland wird für den Begriff Ökologische Bauaufsicht auch das Wort „Umweltbaubegleitung“ verwendet bzw. neu eingeführt. Eine Ökologische Bauaufsicht wird bei Projekten im Alpenraum häufig für erforderlich gehalten, sie ist jedoch in der Naturschutzgesetzgebung nicht vorgesehen.
Bewertung der Ökologischen Bauaufsicht
Als Vorteile für die Skigebiete werden übereinstimmend folgende Aspekte genannt:
Die Ökologische Bauaufsicht trägt dazu bei, dass
- sensible Bauphasen, z. B. mit hoher Erosionsgefahr, mit Maßnahmen zum Verpflanzen von Vegetation oder potenzieller Betroffenheit von Grund- oder Oberflächenwasser, sachgerecht im Planungsablauf berücksichtigt werden,
- Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Belastungen sachgerecht umgesetzt und
- Verzögerungen durch ökologische Projektergänzungen vermieden werden.
Dies kann zu Zeit- und Kostenersparnis in der Bauphase beitragen. Darüber hinaus wird eine Beweissicherung und Dokumentation einer zulassungskonformen Eingriffsgenehmigung geleistet.
Weitere Beiträge sind – wertvoll gerade in touristisch intensiv genutzten Berggebieten – die Mitwirkung an der baubegleitenden Öffentlichkeitsarbeit des Vorhabenträgers.
Diesen Vorteilen stehen jedoch auch Nachteile und Kritik gegenüber. Regelmäßig erwähnt wurde dabei das Verursacherprinzip, wie nachstehendes Zitat beispielhaft zeigt: „Ein Kernproblem ist sicherlich die Bezahlung durch den Projektwerber. Die Ökologische Bauaufsicht rügt genau die Hand, die sie bezahlt.“ Nur im Bundesland Tirol kann die Bezahlung auch über die Behörde abgewickelt werden.
Kritisch gesehen wird auch die Art der Beauftragung (z. B. Pauschalen oder vordefinierte Bauaufsichtstermine), die die Möglichkeit auf Gefahrensituationen angemessen reagieren zu können und eine regelmäßige Präsenz vor Ort einschränken können.
Von einigen Experten wurde die Ökologische Bauaufsicht auch als „stumpfes Schwert“ gesehen, da sie keine Weisungsbefugnis gegenüber Baufirmen besitzt und kritisierte Arbeitsabläufe allenfalls dokumentieren kann. Bei kleinen Projekten herrschte vielfach auch Unverständnis, warum überhaupt eine Ökologische Bauaufsicht geleistet werden musste.
Unklarheit und Unsicherheit herrschte bei vielen Experten auch hinsichtlich der haftungsrechtlichen Konsequenzen. Wer ist haftbar, wenn – auf Hinweis der Bauaufsicht – von den verbescheideten Plänen des beauftragen Planungsbüros abgewichen wird? Selbst bei nachweisbarem Fehlverhalten hinsichtlich der Bescheidauflagen kann die Ökologische Bauaufsicht in manchen Ländern rechtlich belangt werden und in anderen hingegen nicht.
Übereinstimmung herrschte im Hinblick auf die erforderliche Qualifikation, die eine Ökologische Bauaufsicht mitbringen muss. Hierzu zählt ein einschlägiges Studium an Hochschule oder Fachhochschule mit Zusatzqualifikation. Allerdings wird angemerkt, dass Schulungen und Ausbildungen an Universitäten zwar als unumgänglich erachtet werden, spezifische Kenntnisse werden jedoch nur an wenigen Ausbildungsstätten vermittelt. Daher werden zusätzlich Workshops sowie Seminare zur Fortbildung von Ökologischen Bauaufsichten, Projektwerbern und ausführenden Firmen für erforderlich gehalten.
Hilfestellungen leisten hier auch die Umweltanwaltschaften in den Bundesländern Österreichs. So wurde ganz aktuell von der Landesumweltanwaltschaft Salzburg gemeinsam mit der Wirtschaftskammer ein neuer Leitfaden herausgegeben (www.lua-sbg.at/info-broschueren.html). In Deutschland informiert der Bund Deutscher Landschaftsarchitekten (BDLA) über die Umweltbaubegleitung als Aufgabe von Landschaftsplanern und Landschaftsarchitekten (www.bdla.de/umweltbaubegleitung).
Ulrike Pröbstl-Haider