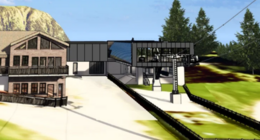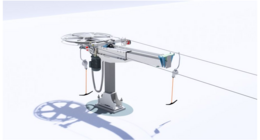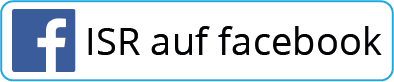Die Voraussetzung für die Errichtung und den Betrieb einer öffentlichen Seilbahn ist in Österreich das Vorliegen einer Konzession. Die Begriffe „öffentliche Seilbahn“ und „Konzession“ sind untrennbar miteinander verbunden. Die rechtliche Grundlage dafür bildet das Seilbahngesetz 2003. So werden in § 5 Seilbahngesetz 2003 öffentliche Seilbahnen als Seilbahnen mit Personenbeförderung, die nach Maßgabe der in der Konzession ausgewiesenen Zeiträume zur Führung eines allgemeinen Personenverkehrs verpflichtet sind, definiert.
Dazu gehören Standseilbahnen, Seilschwebebahnen (Pendelseilbahnen, Kabinenseilbahnen, Kombibahnen, Sesselbahnen sowie Sessel- und Kombilifte), sofern diese nicht als Materialseilbahnen oder als Materialseilbahnen mit Werksverkehr bzw. beschränkt öffentlichem Verkehr genutzt werden. Die Konzession ist die Grundlage für sämtliche nachfolgende seilbahnrechtliche Bewilligungen, wie etwa die Baugenehmigung und die Betriebsbewilligung.
Insofern besteht für jedes neue Seilbahnprojekt ein dreistufiger verwaltungsrechtlicher Genehmigungsprozess (Konzession – Baugenehmigung – Betriebsbewilligung) mit jeweils gesondert durchzuführenden Verfahren. Im Rahmen des Konzessionsverfahrens wird von der Behörde geprüft, ob ein öffentliches Interesse an einer bestimmten Seilbahn gegeben ist bzw. ob das an ihr bestehende öffentliche Interesse die entgegenstehenden Interessen überwiegt.
Letztendlich wird mit der Konzessionserteilung das Bestehen oder das Überwiegen des öffentlichen Interesses an einer bestimmten Anlage (d. h.deren sogenannte „Gemeinnützigkeit“) festgestellt. Zuständig für die Durchführung des Konzessionsverfahrens ist bei allen öffentlichen Seilbahnen, ausgenommen bei Sessel- und Kombiliften, der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie. Für Sessel- und Kombilifteliegt diese Kompetenz beim jeweiligen Landeshauptmann.
Wesen der seilbahnrechtlichen Konzession(Rechte und Pflichten)
Von ihrem Wesen her ist die seilbahnrechtliche Konzession ein höchstpersönliches, nicht übertragbares Recht, auf einem bestimmten Standort [„von“ (Bezeichnung der Lage der Talstation) - „bis“ (Bezeichnung der Lage der Bergstation)] eine Seilbahn zu errichten und zu betreiben. Mit ihr werden nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten begründet. Zunächst zu den Rechten: Die Konzession verleiht die Befugnis, an einem bestimmten Ort eine Seilbahn zu bauen und zu betreiben.
Weiters gewährt sie als ausschließliches Recht den Schutz vor einer unzumutbaren Konkurrenzierung durch eine andere Seilbahn (sei diese öffentlich oder nicht öffentlich). Es darf somit während der im Konzessionsbescheid festgesetzten Konzessionsdauer niemandem gestattet werden, eine weitere Seilbahn zu errichten, die für die Konzessionärin eine nicht zumutbare Konkurrenzierung bedeuten würde.
Zudem hat die Konzessionärin das Recht auf Enteignung hinsichtlich der von der Anlage betroffenen Grundstücke gemäß Eisenbahn-Enteignungsentschädigungsgesetz 1954 (in der Fassung BGBl. I Nr. 112/2003). Zu den durch die Konzession begründeten Pflichten gehört insbesondere die sogenannte Betriebspflicht. Dies bedeutet, dass in den in der Konzession ausgewiesenen Zeiträumen mit der Seilbahn ein allgemeiner Personenverkehr geführt werden muss. Reine Wintersportanlagen sind zumeist nur im Winter zu einer Betriebsführung verpflichtet.
Bei Ausflugsbahnen werden häufig sowohl für den Sommer als auch für den Winter betriebspflichtige Zeiten festgelegt, wobei bei dieser Festsetzung auf öffentliche Interessen Rücksicht genommen wird.
Vorzulegende Unterlagen
Im Konzessionsverfahren werden von der Behörde vor allem die grundsätzliche technische Ausführbarkeit der Seilbahn, die vollständige Erfassung der prognostizierten Baukosten, die Sicherstellung der erforderlichen Finanzierung, die Rentabilität des Projektes, die Fragen der Grundinanspruchnahme, eine allfällige Konkurrenzierung für schon bestehende Anlagen, zu treffende Sicherungsmaßnahmen zur Ausschaltung gegebenenfalls vorhandener Gefährdungen durch äußere Einflüsse, wie z. B. Lawinen oder Wildbäche, – also insgesamt das Vorliegen des öffentlichen Interesses an der Realisierung des Projektes geprüft.
Dazu hat der Konzessionswerber die in § 24 Seilbahngesetz 2003 demonstrativ angeführten Unterlagen gemeinsam mit dem Ansuchen der Behörde vorzulegen.Im Folgenden wird auf einzelne dieser Unterlagen näher eingegangen, welche in der Praxis immer wieder Fragen aufwerfen.
• Umfassende Beschreibung des Bauvorhabens mit Darstellung der örtlichen Gegebenheiten: Diese soll wesentliche Angaben über die geplante Seilbahn und deren Umgebung enthalten – nämlich eine Beschreibung des Zwecks, den die Anlage erfüllen soll (z. B. Ersatz für eine bestehende Seilbahn, Neuanlage, Erfüllung von Zubringerfunktion ins Schigebiet, Nutzung für Wiederholungsfahrten etc.), weiters eine Darstellung der Wasserver- und Abwasserentsorgung, sowie der Energieversorgung, eine Kurzbeschreibung der seilbahntechnischen Anlagenteile, eine Beschreibung der geplanten Stationsbauwerke (Raumaufteilung mit den jeweiligen Funktionen) und dergleichen. Bei der Darstellung der örtlichen Gegebenheiten wäre u. a.anzuführen, ob die Anlage in einem Quellschutz- oder Quellschongebiet errichtet werden soll, bekannte von außen auf die Seilbahn einwirkende Gefährdungen (Lawineneinzugsbereiche, Wildbäche, Sprengmittellager etc.) bestehen oder von der Seilbahn eine Gefährdung für andere Objekte ausgehen könnte.
• Baukostenaufstellung: In dieser sollen die Gesamtinvestitionskosten des Projektesin detaillierter Form aufbereitet werden. Bei mehreren Ausbaustufen sind die Kosten für den Endausbau anzugeben. Die dazugehörigen verbindlichen Firmenangebote sind der Baukostenaufstellung beizulegen.
• Wirtschaftlichkeitsprognose und Finanzierungsplan: Im Finanzierungsplan für das Gesamtprojekt (Endausbau) sind die zum Einsatz kommenden Eigen- und Fremdmittel genau anzugeben. Die entsprechenden Nachweise über deren Aufbringung sind dem Plan anzuschließen. Entsprechend der langjährigen Verwaltungspraxis wird von den Seilbahnbehörden der Nachweis gefordert, dass von der Konzessionswerberin mindestens 50 % der Gesamtinvestitionssumme mittels Eigenmittel finanziert werden können. Als Eigenmittel können z. B. im begrenzten Umfang auch Förderungen von öffentlichen Stellen herangezogen werden, sofern dafür eine verbindliche Zusage vorliegt. Weiters ist es möglich, für einen kleinen Teil der Gesamtkosten den Cash-Flow der kommenden Saison als Nachweis für die Finanzierung zu verwenden, wenn hierfür als Sicherstellung von einem Dritten die Ausfallshaftung im Sinne des ABGB übernommen wird. Bezüglichder Fremdmittel (Darlehen) ist eine verbindliche Promesse eines Kreditinstitutes unter Angabe der vereinbarten Bedingungen vorzulegen.
Die geplante Finanzierung wird von der Behörde immer im Zusammenhang mit der Kapitalausstattung und den bestehenden Verbindlichkeiten der Konzessionswerberin geprüft. Daher sind auch die Bilanzen der Konzessionswerberin für die letzten drei Geschäfts- bzw. Wirtschaftsjahre beizubringen, aus denen insbesondere die in diesen Zeiträumen erwirtschafteten Erträge zu ersehensind.
Durch diese Prüfung soll sichergestellt werden, dass die Konzessionswerberin finanziell nicht nur in der Lage ist, die neue Anlage zu errichten, sondern diese auch im Interesse einer sicheren Beförderung von Fahrgästen ordnungsgemäß zu betreiben. Für die zukünftige Wartung, die Instandhaltung und -setzung der Seilbahn sowie auch die Vornahme von technischen Nachrüstungen (vgl. § 99 Seilbahngesetz 2003) fallen nicht zu unterschätzende Kosten an.
Die langfristige Rentabilität einer öffentlichen Seilbahn ist somit von wesentlicher Bedeutung, weshalb für jedes Projekt auch eine Wirtschaftlichkeitsprognose vorzulegen ist. Zur besseren Nachvollziehbarkeit ist es zweckmäßig, diese Prognose in Form einer anlagenbezogenen Kosten-Nutzenrechnung zu erstellen, bei der den prognostizierten Einnahmen (Anzahl der beförderten Personen x durchschnittlicher Fahrpreis) die Betriebsaufwendungen, wie z. B. für Personal, Energie, Instandhaltung, Versicherung, gegenübergestellt werden. Die Unterlagen betreffend die Finanzierung und die Rentabilität sind von einem dazu Befugten, wie Wirtschaftstreuhänder, Steuer- oder Unternehmensberater, zu erstellen bzw. von einem solchen zu prüfen.
Die in § 24 Seilbahngesetz 2003 enthaltene Aufzählung der im Konzessionsverfahren vorzulegenden Unterlagen ist, wie bereits ausgeführt, demonstrativ. Im Rahmen der einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung kann von der Konzessionswerberin die Übermittlung zusätzlicher Unterlagen verlangt werden.
Amtswegige Prüfung
Im Rahmen der Prüfung des öffentlichen Interesses an der Realisierung eines Projektes erfolgt auch die Betrachtung und Berücksichtigung von Bereichen, die an sich nicht in der Zuständigkeit der Seilbahnbehörde liegen, wie z. B. von Angelegenheiten des Natur- und Landschaftsschutzes sowie des Wasserschutzes.
Die Ergebnisse der diesbezüglich von anderen Verwaltungsbehörden durchzuführenden Verfahren werden von der Seilbahnbehörde in ihre Interessenabwägung mit einbezogen. In der Regel wird daher das Vorliegen einer naturschutzrechtlichen Bewilligung eine wesentliche Voraussetzung für die Konzessionserteilung sein. Weiters wird bei Anlagen, deren Konzessionsverfahren vom Bundesminister geführt wird, dem örtlich zuständigen Landeshauptmann und bei allen anderen Anlagen dem Bundesminister Gelegenheit gegeben, zum neuen Projekt Stellung zu nehmen. Ebenso erfolgt eine Befassung der Gemeinden, deren örtlicher Wirkungsbereich durch die geplante Seilbahn berührt wird.
Diese Anhörungsrechte des Landeshauptmannes und der örtlich berührten Gemeinden dienen dazu, öffentliche Interessen aus regionaler und örtlicher Sicht einzubringen. Häufig werden dabei von den Ländern und Gemeinden Naturschutzinteressen oder Belange des Wasserschutzes sowie begründete Vorstellungen betreffend die festzulegenden betriebspflichtigen Zeiträume bekannt gegeben.
Weiters kommt es im Konzessionsverfahren zu einer amtswegigen Befassung des Forsttechnischen Dienstes für Wildbach- und Lawinenverbauung, welcher eine Überprüfung des Projektes im Hinblick auf allfällige Lawinen- und andere Naturgefahren vornimmt. Die Sicherheit der Benützer der Anlage ist ein ganz wesentliches öffentliches Interesse, dem bei der behördlichen Interessenabwägung höchster Stellenwert eingeräumt wird. Diese Prioritätenreihung im Rahmen eines seilbahnrechtlichen Verfahrens im Zusammenhang mit einer bestehenden Lawinengefahr findet sich u. a. auch höchstgerichtlich ganz klar bestätigt (vgl. VwGH 3.7.1991, 91/03/0019). Zeigt sich im Konzessionsverfahren, dass dem Projekt einzelne öffentliche Interessen entgegenstehen, so ist von der Behörde eine Interessenabwägung dahingehend vorzunehmen, ob tatsächlich das öffentliche Interesse am betreffenden Projekt überwiegt.
Erst wenn ein Überwiegen des öffentlichen Interesses an der Seilbahn festgestellt und auch alle anderen von der Konzessionswerberin vorgelegten Unterlagen als positiv beurteilt wurden, wird die Konzession mittels Bescheid verliehen.Im Anschluss kann von der Konzessionärin um Erteilung der Baugenehmigung für die Seilbahn angesucht werden.
In der Praxis werden aus Zeitgründen zumeist das Konzessionsverfahren und das gesonderte Baugenehmigungsverfahren parallel durchgeführt. Ohne Vorliegen sämtlicher Konzessionsvoraussetzungen kann für eine öffentliche Seilbahn keine Baugenehmigungsverhandlung anberaumt werden, in welcher in der Regel der Baugenehmigungsbescheid erteilt wird. Dies zeigt die wesentliche Bedeutung der Konzession im österreichischen Seilbahnrecht.
Mag. Marianne FritzJuristische Sachbearbeiterin in der Seilbahnabteilung im BMVIT