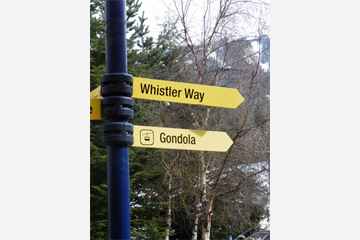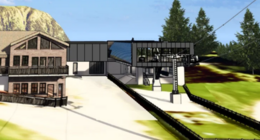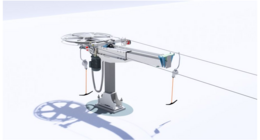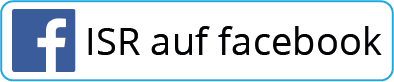Stellen Sie sich vor, sie wären ein Kunde, der einen Skiausflug buchen möchte und sich die Internetseiten verschiedener Unternehmen ansieht. Nehmen wir weiterhin an, dieser Kunde bezieht auch Umweltaspekte in die Entscheidung mit ein, dann sind die Unterschiede zwischen Skigebieten in Österreich und dem großen Ressort in Whistler auf den ersten Blick gering. Umweltbelange sind unmittelbar über die Haupt-Webseite sehr schwer zu finden. Erst wenn man direkt nach Umwelt und dem Namen des Skigebietes googelt, dann erschließt sich die Grüne Seite des Unternehmens in Whistler ähnlich wie in einigen großen österreichischen Skigebieten (siehe ISR 2/2013, S. 66). Ist diese „Hürde“ genommen, dann erwartet einen in Whistler eine perfekte Präsentation erreichter und visionärer Umweltziele im Internet („zero waste, zero carbon, zero net emissions – this is our goal...“) und Hinweise auf das Umweltmanagementteam.
Nachdem wir feststellen können, dass Umweltaspekte in der Schweiz, Deutschland und Österreich für bestimmte Zielgruppen zunehmend relevanter werden, stellt sich die Frage, wie sich dies aus der Sicht des kanadischen Skigebietes darstellt und ob das Thema Umwelt so geringe Relevanz bei der Buchung durch die nordamerikanischen Kunden besitzt, dass Umweltbelange im Internet untergeordnet präsentiert werden. Arthur de Jong, Umweltmanager von Whistler-Blackcomb unterscheidet hier zwischen der Vermittlung von Maßnahmen im Ressort und der Darstellung im Internet. So unauffällig die Umweltinformation auf den Buchungsseiten ist, so auffällig soll Umweltinformation im Gebiet selbst sein. Werbung an den Seilbahnkabinen zum Thema erneuerbare Energie, Plakate zur Abfalltrennung und Displays unterstützen das Umweltmanagement. Ziel ist es, die Gäste anzusprechen, die da sind und ihnen auch die erreichten Ziele zu vermitteln. Hier könnte man sich in Österreich etwas abschauen.
Darüber hinaus seien – so de Jong – die Wintergäste in Whistler allerdings nicht interessiert. Ein wachsendes Potenzial an Besuchern, die sehr stark an Umweltthemen interessiert sind, sieht er dagegen bei den immer mehr zunehmenden Sommergästen in Whistler. Diese haben nicht nur ein großes Interesse an Natur und Umwelt, sondern veranlassen das Unternehmen nicht nur zu vermehrter Umweltkommunikation, sondern auch zu aktiven Maßnahmen im Gelände. Das könnte sich längerfristig auch auf den Winter auswirken, da der Anteil der Gäste, die im Sommer und Winter kommen, zunimmt.
Anstöße durch die Gemeinde zu mehr Umweltengagement und zu mehr Kommunikation dieser Inhalte haben seit den Olympischen Spielen und den letzten Wahlen insgesamt eher abgenommen. In diesem Zusammenhang sieht sich das Unternehmen auch als Ideengeber und Ansporn über die eigenen Belange hinaus. Als Beispiel ist das neue Wasserkraftwerk zu nennen, das erneuerbare Energie liefert.
Der Blick auf die Webseite zeigt uns auch, wie hochdekoriert Whistler ist. Nicht erst durch die olympischen Spiele wurde das Thema Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung hier frühzeitig angesprochen. Dies schlägt sich in zahlreichen Auszeichnungen nieder. Allerdings sind „harte Bewertungen“, wie sie Zertifizierungen (externe Audits oder ISO-Normen) vermitteln, in der langen Liste nicht enthalten. Aus der Sicht des Unternehmens ist diese Diskrepanz einfach zu erklären: Als wichtigste Umweltkommunikationsschiene wird die journalistische Berichterstattung über Whistler gesehen, die besonders an Awards anknüpft. Die Leistungen und Verbesserungen, die neben der Öffentlichkeitsarbeit durch eine Zertifizierung zumindest in Europa erreicht werden können, werden offensichtlich nicht gesehen. Hierzu zählen in Österreich u. a. transparente Umweltdaten und Dokumentation, Versicherungsaspekte, Umwelthaftungsfragen, Managementvorteile und die Mitarbeitermotivation.
Dies liegt vielleicht auch daran, dass Whistler sich intern seit den 90er Jahren sehr systematisch ein grünes Profil aufgebaut hat und über einen „Unfall“ zum Thema Umwelt gekommen ist. Umweltüberlegungen haben daher eine längere Geschichte und spiegeln sich auch in Mitarbeiterbefragungen wider. Dies lässt sich auch in Zahlen belegen: Die Mitarbeiterzufriedenheit liegt bei 72 %, die Mitarbeiter sind zu über 80 % überzeugt, in einem umweltfreundlichen Unternehmen zu arbeiten. Beides sind wichtige Motive, sich für diesen Arbeitgeber zu entscheiden und nach Whistler zu ziehen.
Im Hinblick auf das Thema Klimawandel wird durch das Unternehmen ein offensiver, vorausschauender Weg eingeschlagen. Auswirkungen des Klimawandels lassen sich hier ebenfalls bereits an den Gletschern ablesen. Der Gletscherrückgang sei – so die Aussagen des Unternehmens – weniger durch einen geringeren Schneefall verursacht, als vielmehr durch erhöhte Temperaturen im Sommer, die zu beobachtbaren Rückgängen führen. 2014 wurde zum Thema Klimawandel und Strategien des Unternehmens ein eigenes internes Dokument erstellt. Im Mittelpunkt stehen, wie im Alpenraum, Strategien zur Vermeidung, zur Anpassung und zur Diversifizierung des Angebots. Bei der Vermeidung wurde durch Strom aus Wasserkraft viel erreicht. Trotz eines weniger schneereichen Winters in der Saison 2013/14 wird hier der möglichen Gefahr durch den Klimawandel weniger mit dem Bau von Beschneiungsanlagen begegnet, die Schneeverhältnisse scheinen für gute wirtschaftliche Ergebnisse auch in solchen Jahren ausreichend. Im Hinblick auf die Beschneiung als wichtiges Mittel der technischen Anpassung zeigen sich daher große Unterschiede. Der Anteil der beschneibaren Skigebietsfläche ist in den großen europäischen Skigebieten mit oft über 80 % in den großen Gebieten viel höher. Erhebliche Anstrengungen werden in Whistler vor allem in die Diversifizierung des Angebotes und den Aufbau einer „all year round season“ getätigt, wobei es auch um neue Produkte und Investitionen in naturtouristische Angebote geht.
Die Philosophie des Unternehmens ist es, mögliche Umweltbelastungen durch den Wintertourismus oder den Klimawandel und seine Folgen nicht herunterzuspielen und zu versuchen NGOs davon zu überzeugen, dass der Wintersport das Beste für die Umwelt ist, sondern im Gegenteil proaktiv zu argumentieren und zu sagen: „Wir wissen, wo die Probleme sind, hier sind unsere Leistungen in diesem Bereich und“, fügt Arthur de Jong hinzu, „wir wissen auch, dass wir noch viel tun müssen.“
Dazu wäre allerdings eine Zertifizierung durch externe Gutachter auch ein sehr überzeugendes Argument und Instrument, wie die Beispiele Lech am Arlberg, das Kitzsteinhorn oder die Schmittenhöhe-Bahn belegen. Dies ist vor allem auch dann zu empfehlen, wenn in absehbarer Zeit in der Umweltbilanz wirklich überall eine Null vorne stehen soll.
Ulrike Pröbstl-Haider