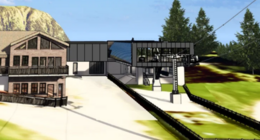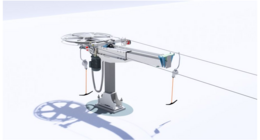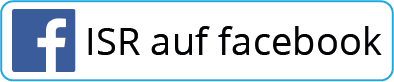Auf Grund der EU-UVP‐Änderungsrichtlinie 2014/52/EU vom 16. April 2014 muss die nationale UVP-Gesetzgebung bis zum 16. Mai 2017 an die internationalen Vorgaben angepasst werden. Im Gegensatz zu anderen EU-Staaten muss Österreich allerdings nur einzelne Aspekte ergänzen, da eine Vielzahl der von der EU geforderten Neuerungen bereits im österreichischen UVP-Gesetz verankert ist.
Ein neuer Bereich ist die Berücksichtigung von Klimawandelfolgen. Neben der in Österreich bereits in das UVP-Verfahren integrierten Beschreibung von Projektauswirkungen auf das Klima – Stichwort „Klima- und Energiekonzept“ – wird nun auch gefordert, die Anfälligkeit von Projekten und Projektumwelt in Bezug auf den Klimawandel zu bewerten. Was umfassen diese Neuerungen bzw. wie können das Projekt bzw. die Projektumwelt vom Klimawandel betroffen sein?
Auswirkung meteorologischer Phänomene
Einerseits kann sich die Änderung der meteorologischen Phänomene direkt auf das technische Bauwerk / die Infrastruktur und den Betrieb einer Einrichtung auswirken. Beispielsweise können verstärkt auftretende kleinräumige Starkwinde zu vermehrten direkten Schäden bei Leitungsinfrastruktur führen. Andererseits nimmt der Klimawandel Einfluss auf die Umwelt, in die das Vorhaben eingebettet ist. So können z. B. veränderte Temperaturverhältnisse die Lebensbedingungen von Tier- und Pflanzenarten modifizieren oder Starkregenereignisse die Bodenlabilität erhöhen und damit die Wahrscheinlichkeit von Rutschungen verstärken. Die veränderte Umwelt kann wiederum Rückwirkung auf das Projekt zeigen – im Falle der vorhin erwähnten Bodenlabilität würde das im alpinen Bereich durch Hangrutschungen, Murgänge und Kriechhänge passieren.
Wie die Änderungsrichtlinie in Österreich tatsächlich umgesetzt und was gefordert wird, ist derzeit in Ausarbeitung bei den zuständigen Stellen. Die internationale Diskussion zum Themenbereich UVP und Klimawandel sieht folgende Punkte als zu beachtend: Zunächst sind die direkten Einwirkungen des Klimawandels auf das Projekt darzustellen. Dabei sind die durch den Klimawandel in veränderter Häufigkeit oder Intensität auftretenden meteorologische Phänomene zu beachten. Für Großprojekte sind dabei insbesondere Extremereignisse von hoher Relevanz. Das Projekt envisage-cc (Dallhammer et al. 2015) hat versucht, die wichtigsten möglichen Auswirkungen für Seilbahnprojekte in einem Datenblatt zusammen zufassen. Es dient allerdings nur zur Orientierung. Die Wichtigkeit der einzelnen Aspekte bzw. Eintrittswahrscheinlichkeit muss nach den lokalen Gegebenheiten beurteilt werden. Zudem gibt es für viele Risiken auch bereits technische Anpassungsmaßnahmen, die in der Seilbahnplanung bereits berücksichtigt werden (z. B. Sicherheit bei Starkwindereignissen).
Die negativen Einwirkungen von verändert auftretenden meteorologischen Phänomenen auf das Projekt können sich direkt einstellen, aber auch in einem indirekten Zusammenhang mit der in der UVP betrachteten Projektumwelt stehen (siehe Tabelle). Aus diesem Grund können auch Informationen, die die Projektumwelt und damit die im UVP-Verfahren berücksichtigten Schutzgüter betreffen, für die Projektplanung relevant werden.
Sensitivität der Projektumwelt
Darüber hinaus können sich Änderungen bei der Sensitivität der Projektumwelt ergeben, die möglicherweise in der Beurteilung der Projektauswirkungen relevant werden. In Folge sind einige Beispiele genannt, die besonders auf Berggebiete zutreffen. Wie bereits angesprochen ändern sich in (hoch)alpinen Lagen die Rahmenbedingungen für die Renaturierung und Pflege für das Schutzgut Boden. Insbesondere bei Skipisten und Projekten mit größeren Geländeeingriffen spielt die erhöhte Sensitivität des Bodens eine verstärkte Rolle (z. B. bei der Standortwahl oder bei der Planung von tieferen Fundamenten). Bei Hangsicherungsmaßnahmen (Bepflanzung, Aufforstung) wird in Zukunft bei der Pflanzenwahl auf das verstärkte Auftreten von Starkregenereignissen und andererseits Dürreperioden zu achten sein, um hier zum Standort passende (autochthone) und gleichzeitig widerstandsfähige Arten zu wählen. Die mittlere Temperaturzunahme kann auch zu einem höheren Schädlingsbefall führen. In diesem Zusammenhang wäre auch eine mögliche eingeschränkte Wirkung von Schutzwäldern abzuklären.
Auf Grund einer mittleren Temperaturveränderung (Jahresdurchschnittstemperatur erhöht sich) und der veränderten Niederschlagsbedingungen sind Arealverschiebungen und Veränderungen der Artenzusammensetzung wahrscheinlich. Insbesondere bei Amphibien und bei den Vögeln werden bereits heute Veränderungen des Wanderverhaltens sowie der Wahl der Standorte zur Überwinterung festgestellt. Ebenso sind Änderungen in der Populationsgröße sowie beim Brutverhalten (breeding phenology) zu beobachten.
Als hoch klimawandelvulnerabel gelten insbesondere Arten mit geringer Standorttoleranz, kälte- und feuchtigkeitsliebende Arten. Gerade im alpinen und hochalpinen Bereich wurden im Rahmen von internationalen Forschungsvorhaben (wie GLORIA – GLobal Observation Research Initiative in Alpine Environments) bereits Verschiebungen in der Artenzusammensetzung beobachtet, wobei insbesondere hochalpine, endemische Arten betroffen sind. Der Schneehase ist ein Beispiel für eine Säugetierart, dessen Habitatgrenze in den letzten Jahren um einige Höhenmeter nach oben gewandert ist. Gerade bei Projekten im hochalpinen Bereich wie Skipisten könnte dieser Aspekt für die Einstufung der Seltenheit dieser Arten bzw. der fehlenden Wiederherstellbarkeit von Lebensräumen ein Thema werden.
Aufgrund einer mittleren Temperaturveränderung kommt es weiterhin zu einer bereits beobachteten Erhöhung der Wassertemperatur und damit zu veränderten Sauerstoffverhältnissen in Gewässern. Ebenso ist eine Versauerung von Süßgewässern möglich. Diese können Artenverschiebung und -verluste in Fließgewässern und Seen auslösen (vor allem Gefährdung der Äschen- und Forellenregion). Veränderte Niederschlagsverhältnisse könnten in Kombination mit den genannten gewässerökologischen Veränderungen in Zukunft z. B. auch bei der Wasserentnahme relevant werden.
Auswirkungen auf Projektwerber
In welchem Umfang sind die angeführten Veränderungen nun zu beachten bzw. was kommt auf den Projektwerber (das Seilbahnunternehmen) zu? Gemäß Art. 5 Abs. I fordert die Änderungsrichtlinie die Berücksichtigung des „gegenwärtigen Wissensstandes und aktueller Prüfmethoden“. Nach Ansicht von deutschen Juristen wie Sangenstedt (2014) kann es darum nicht Aufgabe des Projektwerbers sein, Grundlagendaten zu Klimawandel bzw. Beeinflussung auf die Projektumwelt zu erheben. Auf Grund der UVP-Änderungsrichtlinie könnten jedoch bei zentralen Schritten der UVP, wie der Prognose der Entwicklung (Nullvariante) und der Bewertung der Projektauswirkungen auf die Schutzgüter sowie der Ableitung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Klimafolgen an Bedeutung gewinnen und, soweit auf Grund der aktuellen Datenlage möglich, zu beachten sein.