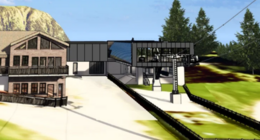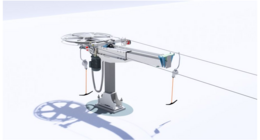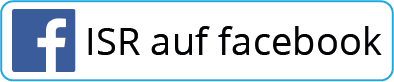Zum Einstieg der Fachveranstaltung für die Tourismus- und Bergbahnbranche, veranstaltet von der Universität für Bodenkultur in Kooperation mit der Stiftung „pro natura – pro ski“ am 15. März in Saalfelden, befasste sich Mag. Peter Wolfsgruber von Horwarth HTL mit dem Größenvergleich und Trends der nationalen und internationalen Zusammenlegungsprojekte in den letzten Jahren. Dabei wurde deutlich, dass Einzelprojekte auch die Voraussetzung für riesige, über mehrere Bundesländer zusammenhängende Fusionen ermöglichen, da oftmals inzwischen nur mehr ein bis zwei Liftverbindungen fehlen, um eine größere Anzahl an Gebieten zu verbinden. Mit der steigenden Größe zeigte Mag. Wolfsgruber aber auch die in Korrelation stehende Preiserhöhung auf. Hier sah er im Vergleich mehrerer Gebiete in Österreich ab einer Anzahl von mehr als 170 Pistenkilometern einen deutlichen Sprung bei den Tagespreisen.
Während die Größe bei allen Bewertungsportalen derzeit das ausschlaggebende Kriterium für eine gute Reihung ist, so könne nur ein sehr kleines Segment an Gästen dieses Angebot an Bergbahnen tatsächlich nutzen. Mag. Wolfsgruber wies auf eine Studie hin, die zeigt, dass tatsächlich nur zehn Aufstiegshilfen durchschnittlich vom Skigast pro Tag genutzt werden. Insgesamt betonte Mag. Wolfsgruber auch, dass sich die Skigebiete inzwischen in einem global stagnierenden Markt bewegen.
Ebenso wie Mag. Wolfsgruber analysierte Dr. Roland Zegg von grisch consulta zunächst Veränderungen bei den touristischen Märkten. Im Vergleich zu Österreich zeigte sich dabei für die Schweiz eine deutlich ungünstigere Entwicklung in den letzten Jahren. So hat man dort zirka ein Drittel der Skigäste in den letzten Jahren verloren. Durch die Bewerbung neuer internationaler Märkte wurde versucht, dieser Entwicklung gegenzusteuern. Erschwerend kommt hinzu, dass im inländischen Markt der hohe Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund ein abnehmendes Interesse an Winterurlaub und eine geringere Verbundenheit mit den Bergen als Erholungsort bewirkt.
Zusammenlegungen waren deshalb in den letzten zehn Jahren ein Mittel, um die Medienwirksamkeit der einzelnen Gebiete zu stärken und ein Versuch, durch Synergieeffekte negative Entwicklungen auszugleichen. Dr. Zegg zeigte aber auch auf, dass diese Ambitionen nicht immer erfolgreich waren. Hier wird der „Synergie-Humburg“, wie Dr. Zegg die „Illusion mancher Businesspläne“ bezeichnet, deutlich.
Er betonte weiterhin, dass Zusammenschlüsse nur unter bestimmten Voraussetzungen gelingen können. „Es bring nichts, vier Kranke ins Bett zu legen und zu hoffen, dass ein Gesunder dabei herauskommt“. Als wichtigste Voraussetzungen nannte er demnach die „finanzielle Sanierung aller beteiligter Unternehmen vor der Fusion“, „die Entwicklung einer starken Vision“, „Ethik, Respekt und Fairness“, „Beachtung von betrieblicher Kultur und Historien“, sowie „externe Projektbegleitung“, die alle Perspektiven wahrnimmt.
Ob und inwieweit Skigebietsverbindungen von den Gästen auch tatsächlich nachgefragt werden, untersuchte Prof. Dr. Ulrike Pröbstl-Haider von der Universität für Bodenkultur in ihrem Vortrag. Sie stellte eine aktuelle Studie der Universität für Bodenkultur vor, die versucht hat Einflussfaktoren auf die Destinationsentscheidung von Skigästen abzuleiten, zielgruppenspezifische Prognosen zu untermauern und Entwicklungsszenarien durchzuspielen in Hinblick auf das zukünftige Buchungsverhalten von Wintersporttouristen in Tirol. Die Besonderheit der Studie lag darin, dass die für die Skigebietsentwicklung relevanten Kriterien, wie Schneesicherheit, Pistenkilometer, öffentliche Anbindung, Schwierigkeitsgrade und Erlebnisqualität, nicht separat, sondern im Verbund abgefragt wurden. Insgesamt wurden 973 Urlauber und 189 Tagesbesucher aus Deutschland sowie 457 Urlauber und 292 Tagesbesucher aus Österreich online befragt.
Die Urlauber mussten mehrfach Wahlentscheidungen zwischen zwei Skigebieten treffen, während die Tagesbesucher zehn Ausflüge auf drei zur Auswahl stehende Gebiete mehrfach verteilen mussten. Insgesamt zeigte sich, dass Pauschalurteile wie die, dass Zusammenlegungen automatisch mit einer Attraktivitätssteigerung verbunden sind, mit Vorsicht zu genießen sind. So ist die Urlaubergruppe der preisbewussten Familie durchaus an kleinen Skigebieten interessiert, wenn der Preis, die Schneesicherheit und die Schwierigkeitsgrade der Pisten stimmen (z. B. kein hoher Anteil an schwarzen Pisten vorhanden ist).
Es zeigte sich weiterhin, dass Details, wie „Ski-in-Ski-out-Angebote“ oder die Nähe zu Gletscherskigebieten und das oft sehr unterschiedliche Landschaftserlebnis die „traditionell“ angeführten Einflussgrößen, wie Pistenkilometer, Schneesicherheit (z. B. Anteil der Pisten über 1.500 m ü. M.) und Schwierigkeitsgrad (Anteil blauer, roter und schwarzer Pisten), „überstimmen“ können. Der Vergleich verschiedener Skigebiete, großer und kleiner, ergab daher durchaus überraschende Ergebnisse.
Wenn durch eine Zusammenlegung der Weg ins Skigebiet vom Hotel aus erleichtert wird, ein Umfang von über 75 Pistenkilometern erreicht wird und die Schwierigkeitsgrade in einem ausgewogenen Verhältnis angeboten werden, so kann – wie die Ergebnisse zeigen – ein Zusammenschluss mehr Urlauber bringen. Eine wichtige Rolle spielt jedoch der Preis. Dieser ist für mehrere Zielgruppen ein entscheidendes Kriterium. Abschließend wurde auch deutlich, dass die Interessen und Präferenzen der Tagesbesucher sich von denen der Urlauber unterscheiden. Hier ist die einfache Formel „Größer ist auch attraktiver“ ebenfalls nicht zutreffend.
Dr. Robert Steiger von der Universität Innsbruck zeigte in seinem Beitrag etwaige Vor- und Nachteile von Zusammenlegungen in Bezug auf die Empfindlichkeit des neuen Verbundes gegenüber Klimawandelfolgen auf. Während große Gebiete den steigenden Beschneiungsaufwand besser verkraften können, so werden Teilerschließungen bei gleichzeitig hohen Ticketpreisen und damit einhergehenden gesteigerten Erwartungen in große Gebiete vom Kunden kaum (und wenn, dann nur in den Saisonrandzeiten) toleriert. Ebenso könnten gerade neuralgische Punkte an den Übergängen von einem Gebiet zum anderen Probleme verursachen – sofern die Verbindung über die Talräume oder niedrig gelegenere Pisten erfolgt.
Paneldiskussion
Im Rahmen der abschließenden Paneldiskussion waren nochmals alle Perspektiven des Vortragsteils durch ein internationales, fachlich breit differenziertes Referententeam abgebildet.
Die Belange von Natur und Umwelt wurden durch Dr. Johannes Kostenzer, Umweltanwalt des Landes Tirol, repräsentiert. Er betonte, dass es vor allem um eine „qualitative Flächenbilanz“ gehe im alpinen Lebensraum und nicht um eine Quantitative. Selbst wenn es später bei Scheitern eines Vorhabens einen „geordneten Rückzug gäbe“, so könne mancher Schaden nicht wieder gut gemacht werden. Abschließend stellte er fest, dass er nicht grundsätzlich ein Problem mit Zusammenschlüssen habe, sondern es darum gehe „unwiederbringliche Lebensräume“ zu bewahren.
Dass Fusionen auch in Hinblick auf die ökologischen Auswirkungen „abgemildert“ werden können, betonte Dr. Marc Winkler, Geschäftsführer der Sextner Dolomiten. Beim zweiten Anlauf, der inzwischen bereits realisierten Verbindung zwischen vier italienischen Skigebieten, wurde zunächst durch genaue Aufnahmen im Gelände identifiziert, wo die tatsächlichen Konfliktpunkte liegen. Danach wurde laut Winkler versucht „zu vermeiden, was zu vermeiden geht, danach vermindern, was möglich ist, und was übrig blieb durch Ausgleichsmaßnahmen zu kompensieren“. Die Bemühungen wurden – auch von den vormaligen Gegnern des Projektes – positiv honoriert.
Prof. Urs Wagenseil von der Hochschule Luzern, mit eigener langjähriger Erfahrung im Destinationsmanagement in Wintersportgebieten, nahm in Hinblick auf die Nachfrage von Großskigebieten eine kritische Position ein. Wichtiger als die Anzahl an Pistenkilometer sieht er die Gesamtpallette des Angebots. Aus seiner Sicht seien die „Hardcore-Skifahrer“, die ihren Ehrgeiz in die Bewältigung möglichst großer Pistendistanzen legen, weniger bedeutsam für den wirtschaftlichen Erfolg als die vielfältigeren Bedürfnisse der anderen Gästesegmente.
Demgegenüber gab PR-Berater Karl-Heinz Zanon zu bedenken, dass die meisten Gäste bei ihrer Heimkehr dennoch über die Größe des Gebiets berichten wollten. „Die kleinen kuscheligen Geheimtipps sperren halt reihenweise zu“, so seine Meinung.
Prof. Wagenseil merkte abschließend an, dass derzeit viele Maßnahmen bei Zusammenschlüssen auch aus öffentlichen Mitteln mitfinanziert werden und gesellschaftlich hinterfragt werden muss, in welchem Ausmaß eine Region bzw. Volkswirtschaft sich das leisten kann.
Weitere Informationen, Vorträge und Fotos finden Sie unter bergumwelt.boku.ac.at