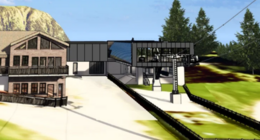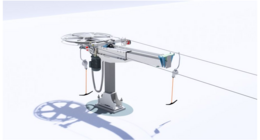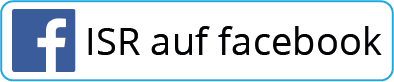Förderleistung
Die Anzahl der Personen, die von einer Seilbahn pro Stunde und Richtung maximal befördert werden können, wird als Förderleistung bezeichnet. Sie ist ein wesentlicher Parameter für die Wahl des Seilbahnsystems und der maßgebenden Einflussgrößen. Es sind dies:
- Fassungsraum der Fahrzeuge,
- bei Pendelbahnen die Dauer eines Fahrtspiels,
- bei Umlaufbahnen die Folgezeit der Fahrzeuge.
Pendelbahnen: Die Aufeinanderfolge zweier Pendelbahnfahrten wird als Fahrtspiel bezeichnet. Die Dauer eines Fahrtspiels ist das Zeitintervall zwischen zwei aufeinanderfolgenden Abfahrten eines Fahrzeuges aus einer Station. Sie setzt sich zusammen aus der Fahrzeit zwischen den Stationen und der Haltezeit in der Station. Als Zeiteinheit wird die Sekunde (s) verwendet.
Die Förderleistung pro Stunde und Richtung ergibt sich als Produkt aus der Anzahl der Fahrtspiele pro Stunde und dem Fassungsraum der Fahrzeuge.
Ein Beispiel:
Die Fahrzeit zwischen den Stationen einer Pendelbahn betrage sechseinhalb Minuten (390 s), die Haltezeit in der Station 50 s, der Fassungsraum der Fahrzeuge 80 Personen (P). Die Anzahl der Fahrtspiele pro Stunde ergibt sich zu 8,18 (3.600 : (390 + 50) = 8,18), die Förderleistung zu 654 (8,18 x 80 = 654) Personen pro Stunde und Richtung (P/h&R, meist nur in P/h angegeben).
Die Fahrzeit hängt hauptsächlich von der Länge der Seilbahn ab: Mit steigender Streckenlänge nimmt die Förderleistung ab. Pendelbahnen eignen sich daher hinsichtlich der Förderleistung gut für kurze Anlagen.
Umlaufbahnen: Das Zeitintervall zwischen der Abfahrt zweier aufeinanderfolgenden Fahrzeuge aus einer Station wird als Folgezeit bezeichnet. Sie hängt vom Abstand der Fahrzeuge am Zug- bzw. Förderseil und von der Fahrgeschwindigkeit ab: Sie ergibt sich als Quotient aus Fahrzeugabstand und Fahrgeschwindigkeit und wird in Sekunden (s) angegeben. Die Folgezeit der Fahrzeuge muss mindestens so groß sein, dass einerseits die Fahrgäste sicher ein- und aussteigen können und andererseits die Durchfahrt der Fahrzeuge durch die Stationen aus technischer Sicht sicher gewährleistet ist (Sicherheitseinrichtungen). Für Seilbahnsysteme mit Umlaufbetrieb (Kabinenbahnen, Sesselbahnen, Schlepplifte) sind in den Seilbahnnormen direkt oder indirekt Mindestwerte für die Folgezeit angegeben.
Zur Förderleistungsberechnung: Bei gegebener Folgezeit der Fahrzeuge beträgt die Anzahl der Abfahrten pro Stunde 3.600 s dividiert durch die Folgezeit. Die Förderleistung pro Stunde und Richtung ergibt sich als Produkt aus der Anzahl der Abfahrten und dem Fassungsraum der Fahrzeuge.
Ein Beispiel:
Eine 6er-Sesselbahn habe eine Folgezeit von 10,0 s. Die Anzahl der Abfahrten pro Stunde ergibt sich zu 360 (3.600 : 10,0 = 360), die Förderleistung zu 2.160 (360 x 6 = 2.160) Personen pro Stunde und Richtung (P/h&R, meist nur in P/h angegeben).
Ein weiteres Beispiel, Berechnung der Förderleistung verkürzt angeschrieben:
Ein Schlepplift mit T-Bügeln (2 Personen) habe eine Folgezeit von 6,0 s. Die Förderleistung ergibt sich zu 3.600 : 6,0 x 2 = 1.200 P/h.
Im Gegensatz zum Pendelbahnsystem ist die Förderleistung beim Umlaufbahnsystem von der Streckenlänge unabhängig. Daher lassen sich hohe Förderleistungen bei langen Seilbahnen nur mit Umlaufbetrieb realisieren.
Beförderungsleistung für Skigebietsbewertung
Um die Beförderungsleistung einer Seilbahn in einem Skigebiet zu bewerten, wird neben der Förderleistung in Personen pro Stunde (P/h) auch die Kennzahl Personenhöhenmeter pro Stunde (PHm/h) angewendet, die sich als Produkt aus Förderleistung und Höhenunterschied der Anlage ergibt. Für die Kapazität des Skigebietes ist es schließlich nicht egal, ob die Skifahrer nach der Seilbahnfahrt eine kurze Piste mit wenigen Höhenmetern oder eine lange Piste mit großem Höhenunterschied benutzen können.
Wirtschaftlichkeit
Die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit eines Seilbahnprojekts ist in der Regel nicht die primäre Aufgabe des Seilbahntechnikers. Voraussichtliche Anlage- und Betriebskosten vor dem Hintergrund der finanziellen Gesamtsituation des Seilbahnunternehmens spielen ebenso eine Rolle wie die Anwendung von Methoden zur Auswahl von Alternativen (z. B. verschiedene Seilbahnsysteme) und Varianten (z. B. verschiedene Trassen für ein Seilbahnsystem). Schlagwortartig seien hier derartige Verfahren genannt:
- Wirkungsanalyse,
- Nutzen-Kosten-Analyse,
- Kosten-Wirksamkeitsanalyse,
- Nutzwertanalyse.
Ein Beispiel für die Anwendung derartiger Verfahren im Seilbahnwesen wird im Beitrag Nutzwertanalyse im Seilbahnwesen in ISR 4/2018, S. 10, beschrieben. Sowohl beim Vergleich verschiedener Seilbahnsysteme als auch bei der Bewertung von Projekt-Varianten kann sich die Durchführung einer Nutzwertanalyse allein schon durch die intensive Befassung mit der Gewichtung und Bewertung von Entscheidungskriterien auf die Transparenz und Treffsicherheit der Entscheidungen positiv auswirken.
Josef Nejez