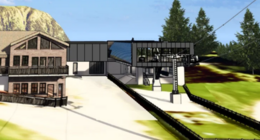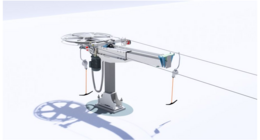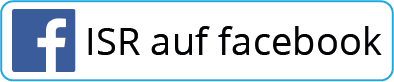ISR: Herr Prof. Dr. Schweizer, Sie haben 1989 in Glaziologie promoviert. Welche großen Entwicklungen auf den Bergen in den letzten 36 Jahren haben Sie erfasst?
Jürg Schweizer: Sehr offensichtlich ist, dass die Gletscher zurückgegangen sind. Das ist ein kontinuierlicher Prozess, wohingegen beim Schneefall aufgrund großer jährlicher Variationen – von sehr schneereichen bis vielen schneearmen Wintern – die Veränderungen weniger offensichtlich sind. Der Trend zu schneearmen Wintern ist unterhalb 1.300 m ü. M. allerdings schon markant, während oberhalb von 2.000 m ü. M. die Schneehöhen im Hochwinter noch nicht so deutlich abgenommen haben. Was ich aus eigener Beobachtung feststellen kann – ich wohne seit über 30 Jahren in Davos: Es regnet heute auch auf 1.560 m ü. M. mehrmals jeden Winter, früher war das selten.
ISR: Eine interessante Aussage aus einer Untersuchung von SLF-Forscherin Stephanie Mayer (über Folgen des Klimawandels auf die Lawinenaktivität oberhalb von 1.800 m ü. M.) lautet, dass weniger Schnee nicht bedeutet, dass es weniger Lawinenabgänge gibt. Warum ist das so?
Jürg Schweizer: Wir bekommen immer wieder einmal zu hören: „Ihr Lawinenforscher habt jetzt keine Arbeit mehr, wenn es weniger Schnee gibt.“ Das wird vielleicht irgendwann der Fall sein, aber in den nächsten 50 Jahren noch nicht.
Auf 2.500 m ü. M. wird es auch Ende des Jahrhunderts noch Schnee geben. Es werden weiterhin Extremereignisse vorkommen, mit zwei Metern Neuschnee innerhalb weniger Tage. Durch die höhere Schneefallgrenze nimmt die Zahl der trockenen Lawinen laut Prognosen ab, Nassschneelawinen oberhalb der Waldgrenze nehmen jedoch zu. Der Schneedeckenaufbau im Winter ändert sich.
ISR: Der Schnee wird „schlechter“?
Jürg Schweizer: Wenn es zwischendurch immer wieder einmal auf und über 2.000 m ü. M. regnet und die Schneedecke feucht wird, können sich beim Wiedergefrieren schwächere Schichten bilden. Außerdem kann in schneearmen Wintern während längerer trockener Phasen in hohen Lagen, wo es noch kalt genug ist, auch eine lockere Schneedecke ohne Kohäsion entstehen. Das ist dann ungünstig, wenn der nächste Schneefall kommt. Am besten für den Schneedeckenaufbau ist, wenn es häufiger bzw. immer wieder einmal schneit. Die Studie von Kollegin Mayer umfasst Schneedeckensimulationen bis Ende des Jahrhunderts. Die Schneedecken werden anders beschaffen sein als heute, mit viel mehr Krusten. Langfristig sollte das eher zu einer stabileren Schneedecke führen – es dürfte also weniger trockene Schneebrettlawinen geben. Wärmeperioden auch im Hochwinter, wenn es auf 2.500 m ü . M. nicht mehr richtig abkühlt und das Thermometer tagsüber 5 bis 8 °C anzeigt, fördern die Gefahr von Nassschneelawinen, die man ansonsten erst im März oder April bei steigenden Temperaturen kennt.
ISR: Eine weitere Aussage aus der Studie lautet, dass „auf Skigebiete und Lawinenwarndienste neue Herausforderungen zukommen“, wenn vermehrt Nassschneelawinen während der touristischen Hochsaison auftreten. Gibt es für Bergbahnen Handlungsmöglichkeiten oder Schutzmaßnahmen?
Jürg Schweizer: Die klassische Prävention im Skigebiet ist das Sprengen nach dem Schneefall, um trockenen Schneebrettlawinen vorzubeugen. Gegen nasse Lawinen Maßnahmen zu treffen, ist schwieriger. Manchmal bleibt einem nichts anderes übrig, als gefährdete Talabfahrten zu sperren.
ISR: Braucht es neue Überwachungsmaßnahmen, wenn sich die Gefahren ändern?
Jürg Schweizer: Es ändern sich vor allem Ort und Zeitpunkt der Gefahren, nicht so sehr deren Natur. Die Lawinengefahr kann man durchaus gut erkennen, sie entsteht im Wesentlichen durch meteorologische Einflüsse. Alles, was mit Niederschlägen in Verbindung steht, können wir dank recht zuverlässiger Wetterprognosen vorausschauend beurteilen. Die Pistensicherungsdienste machen generell einen sehr guten Job. Wird weiterhin so sorgfältig gearbeitet, managt man das auch in Zukunft.
ISR: Verschieben sich aufgrund höherer Schneefallgrenzen die Gefahrenzonen am Berg signifikant?
Jürg Schweizer: Das ist sicher so. Wenn in Anrissgebieten – jenen Hängen, wo Lawinen entstehen – der Schnee fehlt, wird die Gefahr geringer. Wenn es irgendwann nur mehr auf 2.500 m ü. M. Schnee gibt, sinkt die Lawinengefahr bzw. nimmt die Anzahl der Lawinen deutlich ab. Das Gelände, wo Lawinen möglich sind, wird gegen Ende des Jahrhunderts viel kleiner sein als heute. Damit dürften Lawinen künftig auch Tallagen seltener erreichen.
ISR: Insgesamt weniger Schnee bedeutet nicht, dass extreme Schneefälle ausbleiben. Wird deren Häufigkeit steigen, ähnlich den Starkregen-Ereignissen im Sommer?
Jürg Schweizer: Für den Winter lautet die Prognose, dass der Schneefall in den Spitzen etwas intensiver wird, in der Größenordnung von 10 bis 20 Prozent – man erwartet oberhalb von 2.000 m ü. M. also eine gewisse Intensivierung des Schneefalls. Lokale Extremereignisse, wie sie im Sommer durch Konvektion auftreten, sind im Winter nicht zu erwarten, da im Winter Niederschläge mehr durch Fronten geprägt sind.
ISR: Bleiben wir beim Sommer: Die Naturgefahren in den Alpen nehmen bedingt durch den Klimawandel zu – Stichwort Muren oder Steinschläge. In welcher Dimension?
Jürg Schweizer: Großwetterlagen werden stabiler, dauern länger, Extremwetterereignisse nehmen zu, sowohl trockene Perioden als auch Starkniederschläge. Ich erwarte – man hat es in der Schweiz im Sommer wieder gesehen –, dass die Anzahl der Muren zunimmt. Im hochalpinen Bereich kann durch das Auftauen des Permafrosts vermehrt Steinschlag auftreten, ebenso Rutschungen.
ISR: Wenn sich der Permafrost im Hochgebirge erwärmt, was bedeutet das für die Stabilität im Boden und damit die Sicherheit der Infrastruktur am Berg?
Jürg Schweizer: Wir wissen, dass für hochalpine Bergstationen ein zunehmend unstabiler Untergrund ein gröberes Problem darstellt. Es gibt Beispiele, wie man versucht, dem entgegenzuwirken. Jedenfalls braucht es frühzeitig entsprechende Maßnahmen.
ISR: Danke für das Gespräch.
Das Interview wurde am 22. Jänner 2025 telefonisch geführt.