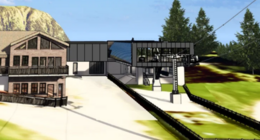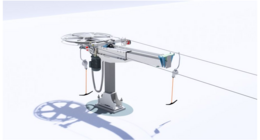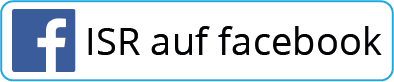Gemeinschaftsrechtliche GrundsätzeDie Richtlinie verpflichtet Unternehmen dazu, die Kosten einer Sanierung nach einem aufgetretenen Umweltschaden zu tragen. Damit sollten sie veranlasst werden, bereits vorbeugend Maßnahmen zur Vermeidung solcher Schäden zu setzen. Die Richtlinie wäre von allen Mitgliedstaaten bis längstens 30. April 2007 in das innerstaatliche Recht umzusetzen gewesen. Tatsächlich war ihre Umsetzung allerdings erst im Juli 2010 abgeschlossen. Da die Richtlinie inhaltlich nicht sehr konkret und bestimmt formuliert wurde, gab sie den nationalen Gesetzgebern bei ihrer innerstaatlichen Umsetzung einen großen Spielraum. Dies führte wiederum dazu, dass die nationalen Gesetze zur Umwelthaftung deutlich voneinander abweichen, was dem angestrebten Ziel einer europaweiten einheitlichen Regelung widerspricht.
Definition des „Umweltschadens“
Als „Umweltschaden“ gilt jede feststellbare nachteilige Veränderung geschützter Arten, natürlicher Lebensräume etc. Dieser Schaden muss eine „erhebliche nachteilige Auswirkung“ auf den Erhaltungszustand dieser Lebensräume oder Arten haben. Übt ein Unternehmen eine – in der Richtlinie definierte – „besonders umweltgefährliche“ Tätigkeit aus, besteht eine verschuldensunabhängige Haftung: Allein die Tatsache, dass ein Umweltschaden eingetreten ist, verpflichtet den Betreiber bereits zu dessen Sanierung. Kommt es hingegen bei einer anderen betrieblichen Tätigkeit zu einem Umweltschaden, so muss dem Betreiber nachgewiesen werden, dass er ein Verschulden gesetzt hat, welches den Schaden ausgelöst hat: Erst nach einem solchen Nachweis kann das Unternehmen zur Sanierung verpflichtet werden. Erfolgt ein Umweltschaden ohne ein nachweisbares Fehlverhalten, so trifft das Unternehmen keine Verpflichtung zur Sanierung. Tätigkeiten von Unternehmen der Seilbahnbranche fallen generell nicht unter die „besonders gefährlichen“ Tätigkeiten, so dass eine verschuldensunabhängige Haftung für diese nicht eintreten kann.
Sanierungsmaßnahmen
Ist nun ein Umweltschaden eingetreten, so ist das Unternehmen verpflichtet, sofort alle Vorkehrungen treffen, um eine Kontrolle, Beseitigung etc. der ausgetretenen Schadstoffe/Schadfaktoren zu erreichen. Weiters muss es umgehend die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festlegen. Diese müssen der Behörde bekannt gegeben werden, die dann darüber entscheidet, welche der vorgeschlagenen Maßnahmen vom Betreiber auf dessen Kosten durchzuführen sind. Ziel der Sanierungsmaßnahmen ist es, die geschädigten Ressourcen ganz oder so gut wie möglich in den Ausgangszustand zurückzuversetzen.
Deckungsvorsorge
Die Richtlinie sieht vor, dass die Unternehmen einen Deckungsfonds zur Sicherstellung der Kosten von Sanierungsmaßnahmen (z. B. durch Versicherungsleistungen) anlegen müssen, dies auch für den Fall einer Insolvenz. Es soll somit jedenfalls ein Deckungsfonds vorhanden sein, um die Sanierungsmaßnahmen finanzieren zu können. Meist wird dieser mittels einer Haftpflichtversicherung erbracht. Als kritisch ist dabei zu beurteilen, dass keine Versicherungsgesellschaft eine Deckung mit einer nach oben unbegrenzten Haftungssumme anbietet. Auf der anderen Seite kann jedoch im Vorhinein nicht abgeschätzt werden, bis zu welchem Betrag sich mögliche Sanierungskosten belaufen können. Laut einem Bericht der Europäischen Kommission liegen die Obergrenzen von solchen „Umwelthaftpflichtversicherungen“ zwischen einer Million und 30 Millionen Euro.
Zusammenfassung
Meiner Meinung nach hat die Richtlinie ihr Ziel verfehlt, da sie in vielen Bereichen unpräzise und „weich“ formuliert wurde. Auf Grund dieses Umstandes weichen die nationalen Bestimmungen in den diversen Mitgliedstaaten voneinander ab, was dem eigentlichen Ziel einer europaweit einheitlichen Regelung widerspricht und unterschiedliche Haftungsmaßstäbe in den diversen Mitgliedstaaten schafft.
Für die Unternehmen der Seilbahnwirtschaft sehe ich durch diese Richtlinie keine deutliche Steigerung des Risikos ihrer betrieblichen Tätigkeiten: Da die Tätigkeiten von Unternehmen der Seilbahnbranche laut der Definition der Richtlinie nicht als „besonders gefährliche“ – im Hinblick auf Umweltschäden – qualifiziert wurden, müsste ihnen nach einem allfälligen Umweltschaden immer ein Verschulden an dessen Zustandekommen nachgewiesen werden. In der Praxis wird es daher kaum möglich sein, Unternehmen der Seilbahnwirtschaft zum Ersatz der Sanierungskosten zu verpflichten.
Christoph Haidlen